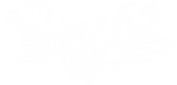Die seit Ende November andauernden Auseinandersetzungen zwischen der ukrainischen Opposition und Präsident Janukowitsch nahmen am 18. Februar eine blutige Wendung. An diesem Tag kündigte die parlamentarische Opposition eine „friedliche Offensive“ zur Unterstützung ihrer Vertreter in der Rada (Nationalversammlung) an, während Gespräche mit der Regierung über eine Verfassungsreform und die Einsetzung einer sogenannten „technischen“ Regierung, die beiden Seiten entgegenkommen sollte, stattfinden sollten.
Nachdem die Großmächte in Europa und Amerika die Proteste gegen die herrschenden Machthaber von Anfang an politisch und materiell unterstützt hatten, waren sie angesichts des Konflikts, der sich jeden Moment zu einem Bürgerkrieg im Zentrum des Kontinents auszuweiten drohte, zunehmend besorgt und hatten den wichtigsten Oppositionsführern dringend geraten, Zugeständnisse zu akzeptieren. So hatten die Oppositionsführer am Tag vor der Demonstration am 18. Februar nicht ohne Schwierigkeiten Hunderte von rechtsextremen Aktivisten dazu gebracht, das Rathaus von Kiew zu räumen, das sie seit dem 1. Dezember besetzt hielten.
Die Rechtsextremen mit ihren bewaffneten und ausgebildeten Gruppen, die seit Wochen auf den Barrikaden des Maidan (ukrainischer Name des zentralen Platzes in Kiew, Hauptquartier der Proteste) Wache standen und die Demonstrationen flankierten, ohne dass die parlamentarische Opposition Einfluss auf sie hatte, schienen die Räumung des riesigen Gebäudes letztendlich akzeptiert zu haben, Bedingung der Behörden für eine Amnestie für Tausende von strafrechtlich verfolgten Demonstranten und die Freilassung von über 200 weiteren.
Wollten die rechtsextremen Aktivisten – die Partei Swoboda (Freiheit), die seit kurzem in der Rada vertreten ist, und mehr noch Pravyi Sektor (Rechter Sektor), eine Koalition von Neonazigruppen, die wieder einmal zur Stelle waren, um die Demonstration mit Helmen, Metallschilden und Knüppeln, Molotowcocktails und sogar Schusswaffen zu flankieren - zeigen, dass sie, „friedliche Offensive“ hin oder her weiterhin entschlossen sind, die Machthaber zu bekämpfen? Fühlten sich die Machthaber auf der anderen Seite wieder in einer Position der Stärke, da die seit Wochen von westlichen Botschaften und Staatsoberhäuptern kommandierten Oppositionsführer bereit waren, sich auf Gespräche einzulassen? Wollte ihre Polizei zeigen, dass sie die Straße weiterhin unter Kontrolle hat, auch wenn sich die Machthaber beschwichtigend zeigen mussten?
Auf das Feuer am Sitz der Partei der Regionen des Präsidenten Janukowitsch folgte das Inbrandsetzen der Zelte der Oppositionellen auf dem Maidan, auf die Kugeln der Polizei folgten Molotowcocktails, auf die Barrikadenstürme die Wiederbesetzung des Kiewer Rathauses: Die Zahl der Toten ging in die Dutzende, darunter auch Polizisten, die Zahl der Verletzten in die Hunderte ... Und unter den Demonstranten befanden sich natürlich, wie jedes Mal, wenn die Ereignisse eine so massive Wendung nehmen, viele Jugendliche, aber auch Menschen jeden Alters, ganz normale Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, die ihre Ablehnung der herrschenden Macht zum Ausdruck bringen wollten, ohne sich deswegen unbedingt mit den rechten Führern und erst recht mit den anwesenden rechtsextremen Gruppen identifizieren zu können.
Die überrumpelten westlichen Regierungen, die auf ein verhandeltes Szenario zur Beendigung der Krise gesetzt hatten und deren Außenminister sich am nächsten Tag mit Janukowitsch treffen wollten, ließen im gleichen Ton wie der UN-Generalsekretär verlauten, dass sie „die Anwendung solcher Maßnahmen [der Gewalt] durch die eine oder andere Seite für inakzeptabel“ hielten. Für sie, die die Oppositionellen aktiv unterstützt hatten, einschließlich ihrer rechtsextremen Randgruppe, die die von westlichen Ministern und Medien geflissentlich übersehen wurde, ging es darum, die Milch, die sie zum Kochen gebracht hatten, wieder in den Topf zu bekommen.
Zwar verkündete Janukowitsch am 20. Februar, er habe mit der Opposition einen „Waffenstillstand“ vereinbart, dennoch gingen die Zusammenstöße weiter. Erneut gab es mehrere Dutzend Tote. Während Kiew in Flammen stand, war die Situation offensichtlich sowohl Janukowitsch als auch seinen Gegnern außer Kontrolle geraten. Die westlichen Zauberlehrlinge ihrerseits sahen das Gespenst eines Bürgerkriegs vor sich aufsteigen und die Gefahr einer Destabilisierung oder gar Teilung des Landes, das so groß ist wie Frankreich und fast genauso viele Einwohner zählt. Und bei einem solchen Lauffeuer würde aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dabei bleiben, da Russland den Abbruch der Beziehungen zur Ukraine, die es als Teil seiner selbst betrachtet, nicht hinnehmen kann. Wie konnte es dazu kommen?
Entstehung einer großen Krise im Herzen Europas
Der Funke, der zur Eskalation führte, war die Weigerung des ukrainischen Präsidenten Janukowitsch, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union (EU) zu unterzeichnen, über das die Behörden seit fünf Jahren verhandelt hatten, und dies am Vorabend des EU-Gipfels in Vilnius am 28. und 29. November 2013. Die Demonstranten besetzten den Platz der Unabhängigkeit, den großen Platz (ukrainisch: Maidan), benannten ihn in Euromaidan um und besetzten verschiedene Gebäude, darunter auch solche, in denen normalerweise die Machtorgane sitzen.
Die Behörden gingen gewaltsam dagegen vor. Es gab Tote durch Schüsse und Hunderte Verletzte. Mitte Februar gab es Hunderte Verhaftungen und über 2.000 Gerichtsverfahren gegen Demonstranten, denen bis zu 15 Jahre Haft drohten. Eine der Hauptforderungen der Bewegung war eine vollständige und wirksame Amnestie. Weitere Forderungen, die jedoch nicht von allen an der Bewegung beteiligten Strömungen unterstützt wurden, waren die sofortige Abhaltung von Wahlen, der Rücktritt des Präsidenten (die Regierung war bereits zurückgetreten) und die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Und natürlich die Neuauflage des Assoziierungsabkommens mit der EU.
Die Repressionen, die Mitte Januar mit der Verabschiedung von Gesetzen, die jede Form von Protest kriminalisieren, noch einen Schritt weiter gingen, konnten den Protest jedoch nicht brechen. Die Regierung, die sich mit einer tiefgreifenden politischen Krise konfrontiert sah, aus der sie keinen Ausweg wusste, versuchte zu beschwichtigen. Sie verdrängte den Bürgermeister von Kiew, der zum Sündenbock für die Polizeigewalt gemacht wurde. Anschließend nahmen sie Gespräche mit der parlamentarischen Opposition auf. Nachdem die Regierung zurückgetreten war, um dem Präsidenten freie Hand zu lassen, bot er den beiden wichtigsten Oppositionsführern Jazenjuk und Klitschko die Posten des Ministerpräsidenten und des stellvertretenden Ministerpräsidenten an. Sie lehnten ab, da sie befürchteten, dass die extreme Rechte, aber auch ein Teil der Demonstranten, die sich weder in der rechten Opposition noch in faschistischen Gruppen wiedererkennen, sie erneut der Kollusion mit der Macht beschuldigen könnten.
Anfang Februar schien die Regierung, die (für sehr kurze Zeit) den Schlagstock weggelegt hatte, auf eine Abschwächung der Bewegung zu setzen. Sie schien sogar auf ihren Verfall zu setzen, denn die parlamentarische Opposition, die bei den Anführern der Maidan-Besetzung kaum Gewicht hat, schien ohne Perspektiven und jedenfalls ohne Handlungsspielraum.
Da keine der Parteien in der Lage zu sein schien, den Sieg zu erringen, arbeiteten die EU und die USA nun in aller Öffentlichkeit und hinter den Kulissen an einer Kompromisslösung. Sie trafen sich mehrmals mit Oppositionsführern und Janukowitsch und suchten die Zusammenarbeit mit Putin, auf den die ukrainischen Machthaber angeblich hören.
Europa und Amerika waren zugleich Verbündete und Rivalen und wollten sich jeweils als Beender der Krise aufstellen. Der Krise, zu deren Verschärfung sie beigetragen hatten, haftete von Anfang an ein Parfüm von Kaltem Krieg gegen Russland an, da ihre Auswirkungen offensichtlich über die Grenzen der Ukraine hinausgingen und sie insbesondere im Rahmen der sogenannten „Östlichen Partnerschaft“ der Europäischen Union das riesige Gebiet der ehemaligen Sowjetunion bis 1991 umfasste.
Die Manöver der Großmächte
Seit einem Vierteljahrhundert haben die imperialistischen Mächte, die den Planeten beherrschen, immer wieder versucht, Staaten, die aus dem Zerfall der UdSSR hervorgegangen sind, in ihre Einflusssphäre zu bringen. Die drei baltischen Republiken waren die ersten auf der Liste, die in die NATO sowie in die Europäische Union aufgenommen wurden, und nun zwei von ihnen in die Eurozone. Darauf folgte Georgien, das sich um die Aufnahme in die NATO und die Europäische Union bewirbt: Das Land hat übrigens gerade am 28. November 2013 dasselbe Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnet, das von der Ukraine abgelehnt wurde.
Anführer der Offensive zur Eindämmung des russischen Einflusses in der ehemaligen UdSSR, sei es in Osteuropa, im Kaukasus oder in Zentralasien, waren die USA. Die Europäische Union, die zwischen den Interessen und Ambitionen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens hin- und hergerissen ist, tut sich schwer, eine gemeinsame Position in der Ukraine einzunehmen. Polen beispielsweise würde die EU gerne eng an sein ukrainisches Nachbarland binden, da es in ihm eine Reserve an billigen qualifizierten Arbeitskräften sieht und noch mehr einen möglichen Verbündeten, auf jeden Fall aber ein zukünftiges Glacis gegenüber Moskau. Frankreich und Deutschland hingegen wollen keine Lösungen, die die Spannungen mit Moskau verschärfen würden, vor allem weil ihre Regierungen auf den Einfluss Russlands in der Ukraine angewiesen sind, um eine Lösung für die Krise zu finden und den Vertrauensverlust, der mit den Sparmaßnahmen, die die nächste ukrainische Regierung gegen die Bevölkerung ergreifen wird, einhergehen wird, mitzutragen.
Zwar ist Deutschland in den Augen der ukrainischen Opposition die wichtigste Macht auf dem Kontinent und sollte [ihrer Meinung nach] in Ost- und Mitteleuropa - dem historischen Hinterland Deutschlands - eine starke Stimme haben, aber auch Frankreich verteidigt eigene Interessen. In erster Linie die seiner Finanzkonzerne, die den Bankensektor in der Ukraine dominieren, seines Großhandels (insbesondere Auchan) sowie seiner Kapitalisten aus der Lebensmittelbranche oder die Interessen von Leuten, die wie Charles Beigbeder, die ehemalige Nummer 2 des Unternehmerverbands Meder, in die reiche Schwarzerde der ehemaligen Kornkammer des zaristischen Russlands investiert haben.
Die Europäische Union, die zwischen den unterschiedlichen Interessen ihrer Mitglieder hin- und hergerissen ist, hat wohl kaum die Mittel ihrer Ambitionen in der Ukraine. Sicher nicht gegenüber den USA, der größten imperialistischen Macht der Welt, deren Spielfeld von einer ganz anderen Größenordnung ist, was sie jedoch nicht daran hindert, Chevron bei der Förderung von Schiefergas in der Ukraine zu unterstützen, und das nicht erst seit diesem Winter. Das zeigte sich beispielsweise darin, dass die Anführer, die 2004 durch die „orangene Revolution“ ins Rampenlicht gerückt waren, wie Präsident Juschtschenko ihre Augen mehr auf Washington als auf Paris oder Berlin gerichtet zu haben schienen, da diese ihm nichts zu bieten hatten. Auch diesmal kann man auf ganzen Seiten der oppositionellen Lokalpresse, wie Den (Der Tag) vom 4. Februar, Interviews lesen, in denen der amerikanische Botschafter in der Ukraine, nachdem er den Protestierenden seine Unterstützung zugesichert hat, ihnen im Befehlston eines Prokonsuls sagt, was sie zu tun haben: keine gewaltsame Besetzung öffentlicher Gebäude mehr, kein Öl ins Feuer gießen, die Debatten über die „Reformen“ unter den Parlamentariern stattfinden lassen, die Beschwichtigungsangebote des Präsidenten annehmen .... Kurz gesagt: eine von den USA abgesegnete Politik akzeptieren.
Während die Europäische Union Vertreter nach Kiew oder zu Sicherheitsgesprächen über die Ukraine nach München entsandt hat, haben die USA mehrmals ihre höchsten Vertreter nach Kiew geschickt: den Außenminister John Kerry und seine Stellvertreterin für Europa, Victoria Unland. YouTube veröffentlichte eine Diskussion zwischen letzterer und dem bereits erwähnten US-Botschafter, die angeblich von den russischen Geheimdiensten abgefangen wurde. Das sorgte für einen Skandal in den Staatskanzleien, wirft aber vor allem ein Licht auf das Kräfteverhältnis zwischen den imperialistischen Mächten. Man erfährt, wie die beiden US-Diplomaten die ukrainischen Oppositionsführern „managen“, von denen sie glauben, dass sie an die Macht kommen können. Man hört, wie sie über die Regierungsfähigkeit des einen oder anderen diskutieren, was sie von ihm erwarten und was sie von ihm verlangen. Jazenjuk, Timoschenkos rechte Hand und Vorsitzender der Partei Batkiwschtschyna (Das Vaterland), hat offensichtlich die Unterstützung der amerikanischen Verantwortlichen: Sie haben ihn oft getroffen und sagen, dass sie „seine wirtschaftliche Erfahrung und seine Regierungserfahrung“ schätzen. Klitschko, Vorsitzender der Partei Udar (Der Schlag), „muss sich bewähren“ und beweisen, dass er nicht nur auf die Interessen Berlins achtet. Tjahnybok, der Anführer der neofaschistischen Swoboda, der die ukrainische Führung kürzlich aufforderte, die „“kriminellen Aktivitäten des organisierten Judentums“ zu beenden, wurde von Nuland mehrfach empfangen Sie hält ihn für einen der „großen Drei“ der Opposition und möchte, dass er und Klitschko der künftigen Regierung fernbleiben, um einen Jazenjuk, der die Regierung mit dem Segen Washingtons führen würde, von außen zu unterstützen.
Und die Europäischen Union? „Soll sie doch zum Teufel gehen!“, erklärte die amerikanische Vizeministerin. Da ihre Äußerungen in der Öffentlichkeit breitgetreten wurden, musste sie sich entschuldigen. Aber wie heißt es so schön: „Wer die Musiker bezahlt, wählt das Stück aus, das sie spielen werden“. Europa, das gezeigt hat, dass es weder zahlen will noch kann - zumindest nicht, um der Ukraine einen Kredit in Höhe ihrer Forderungen zu gewähren - und das der Opposition gegen Janukowitsch eine Unterstützung gewährt hat, die diese für sehr dürftig hält, kann auch kaum verbergen, dass es sich zwanzig Jahre lang geweigert hat, dem Land auch nur im Geringsten entgegenzukommen. Es sei denn, man betrachtet es als ein Geschenk, dass sie auf ihrem Boden Auffanglager für Migranten ohne Papiere subventioniert hat, als die EU durch die jüngsten Erweiterungen der Europäischen Union an ihrer Ostgrenze in direkten Kontakt mit der Ukraine kam.
Eine „pro-russische“ Politik: standardmäßig, aber nicht nur
Nach dem Zerfall der UdSSR bewarb sich die Ukraine, die unter den Sowjetrepubliken wirtschaftlich und demografisch an zweiter Stelle stand, bei Institutionen der imperialistischen Welt wie der WTO (Welthandelsorganisation), dem IWF (Internationaler Währungsfonds), der BRED (Bank für den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die Entwicklung Osteuropas) und später der EU. Um dies zu untermauern, demonstrierte Kiew seine Unabhängigkeit von Jelzins und später Putins Russland: Unterstützung westlicher, von Russland verurteilten Militärinterventionen; Organisation von Manövern der Seestreitkräfte mit den USA im Schwarzen Meer; Drohung, die Pacht des Militärhafens Sewastopol auf der Halbinsel Krim an Russland nicht zu verlängern; Streit über die Grenzziehung zwischen dem neuen ukrainischen und dem neuen russischen Staat im Asowschen Meer ... Und natürlich gab es wiederholt Konflikte um die russischen Gasleitungen, die zu UdSSR-Zeiten gebaut worden waren, um russisches Gas nach Mittel- und Westeuropa zu transportieren. Kiew drohte damit, den Gashahn für Russlands Kunden und die Deviseneinnahmen des russischen Staates zuzudrehen.
Trotz vieler Wechselfälle scheint die Öffnung gegenüber dem Westen seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Konstante in der Politik aller ukrainischen Präsidenten zu sein, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung. Ebenso konstant war jedoch die Weigerung der Europäischen Union, der Ukraine ihre Tür zu öffnen, zumindest bis zu dem Assoziierungsvertrag 2013, wenn man in dieser Farce eine Öffnung sehen will.
Die Haltung des ukrainischen Staates seit 1991 wurde zum Teil durch diese europäische Politik der geschlossenen Tür bedingt. Aber nicht nur das. Wie hätte Kiew mit Moskau brechen können, nach einem Dreivierteljahrhundert des Aufbaus und Funktionierens einer gemeinsamen, verstaatlichten und geplanten Wirtschaft, die dazu geführt hat, dass die Ukraine und Russland eine eng miteinander verbundene industrielle Infrastruktur haben. Sie gehören beide zu einem auf der Ebene der UdSSR angelegten Wirtschaftsgefüge! Ist es mangelnde Vorstellungskraft oder Dummheit vieler westlicher Kommentatoren: Nicht die Tatsache, dass die ukrainische Führung ihre Augen auf Moskau gerichtet hat, ist verantwortlich dafür, dass ein Drittel des Außenhandels der Ukraine mit Russland abgewickelt wird oder dass Russland als Exportziel weit vor der Türkei liegt, die mit nur 6% der ukrainischen Exporte das zweitwichtigste Ziel ist. Und auch nicht dafür, dass mehr Importe aus Russland kommen als aus Deutschland, das mit 9,4% der Gesamtimporte der Ukraine der zweitwichtigste Lieferant ist. Die ukrainischen Bürokraten und Wohlhabenden sind weder pro-russisch noch pro-europäisch: Sie verteidigen allein ihre räuberischen Interessen, gegen die anderen herrschenden Clans in der Ukraine, übrigens auch gegen ihren eigenen Staat, und natürlich gegen ihre „Partner“, seien es ihre ehemaligen Kollegen aus der russischen Bürokratie oder westliche Kapitalisten, die in der Ukraine Geschäfte machen wollen.
Darauf ist die Verzögerungstaktik Kiews zurückzuführen, das fünf Jahre lang mit Brüssel über ein Abkommen verhandelt hat und sich wenige Tage vor dem Gipfeltreffen in Vilnius, auf dem die „Östliche Partnerschaft“ der 28 mit großem Pomp gefeiert werden sollte, d. h. der Übergang von fünf ehemaligen Sowjetrepubliken (Ukraine, Weißrussland, Armenien, Georgien, Aserbaidschan) in den Orbit der europäischen imperialistischen Mächte, weigerte, das Abkommen zu unterzeichnen.
Während die „Mittelmeerpartnerschaft“ der Europäischen Union, die darauf abzielte, ihren Einfluss und insbesondere den Einfluss Frankreichs auf die Länder rund um das Mittelmeer zu festigen, bereits begraben werden musste, endet ihre „Östliche Partnerschaft“, die von Deutschland, der größten wirtschaftlichen und politischen Macht des Kontinents, getragen wurde, in einem Fiasko: Neben der Ukraine haben Armenien und Weißrussland einen Status, als „assoziierte“ Staaten abgelehnt.
Wirtschaftskrise und „Assoziierungsabkommen“
Als Janukowitsch seine Entscheidung bekanntgab, sagte er, dass sie aus rein wirtschaftlichen Gründen getroffen wurde und nicht endgültig sei: „Ich weiß, dass ich möglicherweise nicht verstanden werde“. Gewiss. Dennoch spiegelt seine Haltung ziemlich gut die Widersprüche wider, in denen sich ein Land wie die Ukraine befindet, dessen Wirtschaft als Produkt der Geschichte nur in enger Verflechtung mit der Russlands existiert. Das imperialistische Europa und das imperialistische Amerika waren nie in der Lage, dem Land ein anderes System als Alternative anzubieten, das die Ukraine als industriell entwickeltes Land erhalten könnte. Und wie sollten sie auch, wenn das gesamte kapitalistische System in einer permanenten und sich verschärfenden Krise steckt?
In ihren Gesprächen mit Brüssel hatte die Ukraine argumentiert, dass die Erschütterungen der weltweiten Finanzkrise von 2007-2008 sie die Knie gezwungen habe und sie daher sofort Kredite in Höhe von 20 Milliarden benötige. Die EU bot ihr 700 Millionen an. Und das zu drakonischen Bedingungen: Die gleichen Bedingungen, die Griechenland auferlegt wurden, oder die der IWF der Ukraine um die Jahrtausendwende „anbot“, als sich die Wirtschaft der Ukraine nach einem Jahrzehnt des Zusammenbruchs, der eine direkte Folge des Verschwindens der UdSSR war, wieder etwas erholte. Heute befindet sich ihre Wirtschaft in einer Rezession, die Staatskassen sind leer und die berüchtigten internationalen Ratingagenturen haben die Kreditwürdigkeit des Landes erst kürzlich wieder herabgestuft, da sie der Ansicht sind, dass das Land am Rande der Zahlungsunfähigkeit steht. Die Folge: Kiew konnte auf den internationalen Märkten keine Abnehmer für seine jüngsten Anleiheemissionen finden, selbst wenn sie Wucherrenditen boten. Was die Landeswährung Gryvna betrifft, so ist ihre Abwertung nach allgemeiner Auffassung unvermeidlich. Und für den Preis eines assoziierten Status verlangten die Entscheidungsträger der EU von Kiew „Reformen, Reformen, Reformen“, wie es der EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik formulierte.
Diese Maßnahmen, so haben die westeuropäischen Regierenden angedeutet, ohne den Inhalt allzu sehr präzisieren zu wollen, würden „schmerzhaft“ sein. Natürlich nicht für die großen Finanz-, Industrie- und Handelskonzerne, insbesondere aus Europa, die bereits in der Ukraine tätig sind und noch mehr Freiheit fordern, um dort Gewinne zu machen. Stattdessen würde die ganze Last dieser Maßnahmen auf den ukrainischen Werktätigen lasten. Ihre Kaufkraft ist bereits stark von der Arbeitslosigkeit betroffen (vor allem im Westen des Landes, wo dies den Vormarsch der ultranationalistischen Swoboda begünstigt hat), und bei einem Durchschnittslohn von rund 700 Euro für einen Facharbeiter in Kiew wird ihre Kaufkraft zudem von der Inflation aufgefressen.
Was die EU vorschlägt, bedeutet das wenige, das die ukrainischen Arbeitenden zum Leben haben, stark zu beschneiden, wie schon Ende der 1990er Jahre beim ersten „Hilfspaket“ des IWF für die Ukraine unter der Schirmherrschaft der EU, als die Gryvna innerhalb von vier Jahren die Hälfte ihres Wertes verlor.
„Oligarchen“, die auf alle Hochzeiten tanzen
Die von der EU mit ihrem Assoziierungsvertrag auferlegten Bedingungen für die Umstrukturierung und die Öffnung der Märkte wären für große Teile der ukrainischen Wirtschaft nachteilig gewesen, insbesondere in der Industrie, die ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes ausmacht. Aber einige Wirtschaftssektoren - Energie, Landwirtschaft ... - oder vielmehr diejenigen, die die Kontrolle über diese Sektoren haben, hätten ein Interesse selbst an diesem sehr unegalitären Abkommen. Das gilt auch für jene Bürokraten und Geschäftemacher, die bereit sind, sich zu Zwischenhändlern der Ausplünderung des Landes durch westliche Kapitalistengruppen zu machen. Aber wie viele andere lokale Privilegierte hätten mehr zu verlieren gehabt als zu gewinnen? Die Antwort auf diese Frage ist offenbar nicht so einfach. Und sie spaltet die Kreise der Mächtigen und Reichen.
Die Haltung, die mehrere ukrainische „Oligarchen“ während dieser Krise eingenommen haben, ist auf jedenfalls aufschlussreich für die Entscheidungen, vor denen die Privilegierten des Systems stehen. Wie Russland hat auch die Ukraine ihre Oligarchen, Mitglieder der Bürokratie, die durch die Ausplünderung der nach dem Ende der UdSSR verstaatlichten Wirtschaft unter den schützenden Fittichen einer herrschenden Kaste gediehen, die politisch weiterhin über den Zugang zu den Quellen des Reichtums entscheidet. Einige von ihnen haben jedoch bereits im Dezember 2013 die repressiven Entscheidungen der Regierung kritisiert und sogar die Proteste unterstützt, manchmal sogar offen.
Von den mehreren Dutzend ukrainischen Oligarchen sind der breiten Öffentlichkeit nur etwa ein Dutzend bekannt, da sie die großen Medien besitzen. Drei von ihnen, Rinat Achmetow, mit 11 Milliarden Euro der reichste Mann des Landes, Viktor Pintschuk und Igor Kolomoisky, standen Schätzungen zufolge für 12% des ukrainischen BIP.
Für die meisten unter ihnen liegt die Quelle ihres Reichtums im Osten des Landes, mit seinen Bergwerken, seiner Stahlindustrie und seiner Petrochemie. Achmetow verdankt seinen Reichtum der Tatsache, dass er zum „Stahlkönig“ im Donbass, der politischen Hochburg Janukowitschs, wurde; ein Sitz in der mächtigen Bürokratie des industriellen Ostens, der es Janukowitsch Ende der 1990er Jahre ermöglicht hatte, Premierminister unter Präsident Kutschma zu werden und seine Schützlinge in vielerlei Hinsicht zu begünstigen.
Dmitri Firtasch hingegen wurde zum Chemie- und Energiemagnaten, immer unter den schützenden Fittichen des Janukowitsch-Clans. Während der vorherigen Regierung, die aus der „orangenen Revolution“ von 2004 hervorging, stand Firtasch nicht in der Gunst von Julia Timoschenko. Als Premierministerin unter Juschtschenko hatte die sogenannte „Gasprinzessin“ die Kontrolle über die Gaspipelines und wollte niemanden an den riesigen Einnahmen, die diese generieren, teilhaben lassen. Nachdem sich die „orangen“ Führer diskreditiert hatten, wurde Janukowitsch 2010 Präsident, diesmal ohne des Betrugs beschuldigt zu werden. Er beendete das Gasimportmonopol und warf Timoschenko, die sich das Gas unter den Nagel gerissen hatte, ins Gefängnis. Firtasch winkte das Glück. Mit der Unterstützung Kiews handelte er mit dem russischen Gasriesen Gazprom ein Abkommen über vergünstigte Gaslieferungen aus, welches es ermöglichte, lukrative Gaslieferverträge mit einigen EU-Ländern abzuschließen.
Petro Poroschenko, der mit den Clans verbunden ist, die durch die „orangefarbene Revolution“ an die Macht kamen, war vor 2010 Minister und ist ein Magnat der Lebensmittelindustrie. Seine Produkte waren als erste von der russischen Zollblockade im letzten Sommer betroffen, als Moskau Kiew einen Vorgeschmack darauf gab, was es Kiew kosten würde, sich an Brüssel zu wenden.
Poroschenko, der dem derzeitigen Präsidentenclan nicht viel schuldet, hat sich in den letzten Monaten immer wieder für die Führung einer möglichen Koalitionsregierung angeboten. Seine Haltung ist das Pedant zu der Haltung anderer Oligarchen, die dem Präsidenten verpflichtet sind und die sich für den Fall dass dieser nicht in der Lage ist, seine Ordnung durchzusetzen, eine Zukunft sichern wollen, Daher gaben sie der Opposition in ihren Zeitungen und Fernsehsendern das Wort und veröffentlichten Erklärungen, in denen sie die Polizeigewalt verurteilten und die Machthaber zu Verhandlungen aufforderten.
Einige gehen sogar noch weiter. Firtasch unterstützt die Udar-Partei des Boxweltmeisters Vitali Klitschko, der zur Galionsfigur der Proteste wurde, finanziell. Als erfolgreicher Geschäftsmann, Schwiegersohn des „pro-russischen“ Ex-Präsidenten Kutschma und Liebling der Partei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit der er finanzielle Beziehungen unterhält, könnte man sagen, dass Klitschko den Wunsch der Wohlhabenden des Regimes verkörpert, nicht alle Eier in denselben Korb zu legen. Kolomoisky, ein weiterer prominenter Oligarch, steht in Verdacht, die neofaschistische antirussische Partei Swoboda zu unterstützen, die in der Anti-Janukowitsch-Bewegung an vorderster Front steht.
Diese Männer aus den Clans und politisch-geschäftlichen Kreisen der postsowjetischen Bürokratie gediehen mit Unterstützung des derzeitigen Präsidentenclans im Rahmen der Verbindungen der ukrainischen Industrie zu Russland. Aber sie haben ihre Aktivitäten auch nach Westeuropa und in die USA diversifiziert. Da sie dort ihr Mafia-Image nur schwer abstreifen können, möchten sie, dass ihre fragile „Respektabilität“ nicht zu sehr unter ihren Verbindungen zu Janukowitsch und Russland leidet. Es missfällt ihnen auch, dass die „Unruhen“, die das Land seit über zwei Monaten heimsuchen, ihre Geschäfte stören oder stören könnten. Also grenzen sie sich ab und versuchen, ihren Schutzschirm auszuweiten und zu diversifizieren.
Für viele beginnt dies damit, sich mit den Männern und Clans zu versöhnen, die derzeit nicht an der Macht sind, die aber im Falle einer Koalitionsregierung oder nach den Präsidentschaftswahlen, die Janukowitsch vorziehen will, an die Macht kommen könnten.
In der Ukraine und in Russland kann bekanntlich niemand ohne eine „Krycha“ (ein „Dach“, diesen Schutz, den man gegen Bezahlung von der Macht erwirbt) auf Reichtum hoffen. Die unerfreuliche Erfahrung des einst reichsten Mannes Russlands, Chodorkowski, der für zehn Jahre in ein Lager geschickt und durch Putins Willen um einen Teil seines Vermögens gebracht wurde, oder die von Timoschenko, einer hochkarätigen Politikerin und Geschäftsfrau, die Janukowitsch trotz der Appelle der europäischen und amerikanischen Regierungen im Gefängnis behielt - auch wenn die Rada am 21. Februar ihre Freilassung beschlossen hat - sind dazu da, die lokalen Neureichen daran zu erinnern, wie prekär ihr privilegierter Status ist. Es ist nur ein kleiner Schritt, sich zu fragen, ob ein Abkommen mit EU-Siegel sie nicht vor ihrem eigenen Staat und den Menschen, die ihn kolonisieren, schützen könnte. Einige wollen wohl glauben, dass dadurch verschwinden könne, was die Coface, die staatliche französische Außenhandelsversicherungsgesellschaft, in Bezug auf die Ukraine als „anhaltende Mängel im Geschäftsumfeld“ bezeichnet. (Von 177 untersuchten Ländern steht die Ukraine auf der Rangliste, die Transparency International Ende 2013 veröffentlicht hat, auf Platz 144).
Außerdem könnte eine Annäherung an Europa sie vor dem Appetit ihrer großrussischen Gegenspieler schützen. Vor allem in einer Zeit der globalen Krise, in der die Ukraine wirtschaftlich besonders geschwächt ist, kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht und weniger, denn je in der Lage ist, mit ihren Partnern zu verhandeln.
Nachdem Janukowitsch den Preis ein wenig in die Höhe getrieben hatte, indem er Brüssel gegen Moskau und umgekehrt ausspielte, erhielt er von Russland das Versprechen, die Preise für Gaslieferungen zu senken und einen Kredit in Höhe von 15 Milliarden Euro zu erhalten. Wenn Moskau sich nicht mit den 4,5 Milliarden zufrieden gibt, die es hauptsächlich zur Tilgung lokaler Forderungen russischer Banken gezahlt hat, und den Rest freigibt, sobald es Zusicherungen darüber hat, was die nächste ukrainische Regierung tun wird, hofft Janukowitsch, dass er seinen Haushalt aufstellen kann.
Damit erregte er jedoch den Zorn eines ganzen Teils der Bevölkerung, der - zu Recht oder zu Unrecht, das ist eine andere Frage - seine Hoffnungen auf den Abschluss eines Abkommens mit der Europäischen Union gesetzt hatte.
Das Kleinbürgertum geht auf die Straße
Indem er dieser Perspektive, die das Regime bis dahin selbst angepriesen hatte, den Rücken kehrte und ein Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau unterzeichnete, löste Viktor Janukowitsch eine schwere Krise aus. Zunächst konnte man meinen, es handele sich um ein Déjà-vu der sogenannten „orangenen Revolution“ von 2004. Doch seit dem 18. Februar ist diese Krise eskaliert. Und sie hat sich zu einer offenen und massiven Konfrontation zwischen der Regierung und ihrer Opposition entwickelt, auch wenn die parlamentarischen Führer der Opposition von den radikaleren Teilen der Demonstranten überrollt worden zu sein scheinen, unter denen - soweit man das aus der Ferne beurteilen kann - die extreme Rechte eine bemerkenswerte Rolle spielt.
Ende November war das Hauptquartier der Proteste, wie schon vor zehn Jahren, der Unabhängigkeitsplatz, der von den Gruppen, die von den westlichen Medien begeistert als europaorientierte Jugendliche dargestellt wurden, in ein verschanztes Zeltlager verwandelt wurde, im Gegensatz zum Präsidenten und der Partei der Regionen, auf die er sich stützt, die als pro-russisch beschrieben werden.
Im Rampenlicht standen sofort wieder einige der Protagonisten der Krise von 2004, allen voran Janukowitsch, der sich damals gerade durch Betrug auf den Präsidentensessel geschlichen hatte, den er unter dem Druck der Straße wieder räumen musste: Seine Nachfolger und die westlichen Führer behaupteten bereits damals, er sei Moskau hörig. Ihm gegenüber steht wie damals Julia Timoschenko. Als Vorsitzende der rechtsgerichteten Partei Batkiwschtschyna sitzt sie wegen Finanzgeschäften aus ihrer Zeit als Premierministerin zugunsten ihres eigenen Clans im Gefängnis, eine banale Sache. Das Pikante an dem Fall ist, dass die Richter diese Dame verurteilten, weil sie einen Gasvertrag mit Moskau unterzeichnet hatte, der die russische Seite unverschämt begünstigte: der Gipfel für eine Persönlichkeit, die sich als pro-europäisch bezeichnet!
Doch seit 2004 haben vor dem Hintergrund der Rezession und der zunehmenden Armut andere Formationen und Politiker den Durchbruch geschafft, die sich alle offen rechts oder ganz rechts im politischen Spektrum verorten: Klitschkos Udar-Partei; die Neofaschisten von Swoboda; die Pronazis von Pravyi Sektor ... Die Reaktionen der Machthaber und der Protest gegen sie fallen zwar viel heftiger aus als vor zehn Jahren, aber vom Inhalt und den Personen her sind an der Spitze der Bewegung und unter denen, die ihr Konsistenz und Image verleihen, die gleichen sozialen Kräfte wie damals zu finden.
Die ersten, die die Entscheidung, Brüssel den Rücken zu kehren, in Frage stellten, waren die Studenten, vor allem die Studenten der privaten Universitäten in der Hauptstadt, die die meisten Zuwendungen von westlichen Regierungen oder Institutionen erhalten. Doch als die Behörden ihre Bereitschaftspolizei auf diese wenigen hundert Protestierenden losließen, brachte die Gewalt der Unterdrückung der Bewegung Zuwachs: Kleinunternehmer aus der Provinz, Kleinbürger aus Kiew, die in einer Stadt, in der der Dienstleistungssektor dominiert, zahlreich sind. Es handelte sich um motivierte Menschen, die sich darüber ärgerten, dass die Chancen, die Europa ihnen geboten hätte und deren hypothetische Auswirkungen auf die viele bereits gewartet hatten, vereitelt wurden. Einige, nicht nur junge Menschen, sahen darin die Möglichkeit, sich stärker der Welt zu öffnen, im Ausland zu studieren und mit weniger Einschränkungen zu reisen. Andere erhofften sich prosaischer Möglichkeiten, Geschäfte zu machen oder ihre eigenen auszubauen, ohne Bestechungsgelder an eine Vielzahl von Parasiten zahlen zu müssen, ohne wie in der Ukraine oder in Russland befürchten zu müssen, dass Bürokraten, die Appetit bekommen haben, Sie ausrauben wollen.
Diese Bestrebungen, denn man muss ihnen einen Namen geben, nennen die einen „Demokratie“, die Nationalisten „Unabhängigkeit von Moskau“ und die anderen „europäischer Geist“. Doch im Grunde genommen haben die Demonstranten in Kiew in diesem Winter und diejenigen, die mit ihnen sympathisieren, dieselben Bestrebungen wie der Großteil der Menschen, die Ende 2011/Anfang 2012 in Moskau gegen Putin protestierten. Sie wollen ein konsumorientiertes Leben führen, frei Geschäfte machen, den sogenannten „amerikanischen Traum“ leben - kurz gesagt, all das, was Millionen von Kleinbürgern in den Großstädten Sowjetrusslands und der Ukraine vor einem Vierteljahrhundert, während der Gorbatschowschen Perestroika motivierte und mobilisierte.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Epochen besteht darin, dass die ukrainischen (oder russischen) Kleinbürger heute mehr oder weniger davon überzeugt sind, dass man ihnen ihren Traum gestohlen hat. Mit „man“ sind „die Diebe und Betrüger an der Macht“ gemeint, um einen Slogan der Demonstranten zu zitieren - und dass sie statt des Kapitalismus, den sie idealisiert hatten, einen Banditenkapitalismus bekommen haben.
Dass die Bürokraten-Geschäftemacher die Ressourcen der ukrainischen (oder russischen) Wirtschaft zu ihren Gunsten beschlagnahmt haben, indem sie Menschen aus dem Weg geräumt haben, die sich als ehrliche Außenseiter des „Geschäfts“ betrachteten, ist eine Tatsache. Dass die Europäische Union für sie einen Kapitalismus des freien Wettbewerbs wiederherstellen könnte, bedeutet, sich einer Illusion hinzugeben. Oder die Seiten eines Geschichtsbuchs rückwärts umzublättern.
Die Ukraine des „europäischen Traums“ einiger Menschen wäre noch offener für westliche Produkte, aber es gäbe noch weniger Menschen, die sich diese Produkte leisten könnten als heute. Denn die von den Führern der Großmächte propagierten „Reformen“ und die zunehmende Verbreitung westlicher Waren, die anderswo für westeuropäische und amerikanische Großkonzerne produziert werden, würden unweigerlich dazu führen, dass viele ukrainische Unternehmen schließen und ihre Beschäftigten auf die Straße gesetzt werden.
Und um sie zu zwingen, ihr Schicksal zu akzeptieren, gäbe es immer noch die Berkut (ukrainisch für „Königsadler“), die Bereitschaftspolizei, aber auch diese faschistischen Gruppen, von denen Swoboda nur die bekannteste ist. Während der Ereignisse der letzten Wochen und vor allem seit Mitte Februar hat sich gezeigt, dass diese Bewegung über Truppen verfügt, dass sie paramilitärische Gruppen mit entsprechender Ausrüstung hat und dass sie von bestimmten westlichen Kreisen und örtlichen Magnaten finanziell unterstützt wird.
Diese Rechtsextremen begnügen sich nicht damit, eine abscheuliche rassistische und arbeiterfeindliche reaktionäre Ideologie zur Schau zu stellen; ihre Fremdenfeindlichkeit und ihr Nationalismus dienen ihnen dazu, die Reihen der arbeitenden Bevölkerung zu spalten, um sie zu schwächen. Im ukrainischsprachigen Westen erklären die Nationalisten alle Übel, unter denen die Bevölkerung leidet, mit dem „Moskauer“ Teufel, der angeblich wie unter den Zaren und unter Stalin versuche, „die Ukraine ihrer Seele zu berauben“, wie sie sagen. In den anderen, weitgehend russischsprachigen Regionen versucht die Swoboda, die soziale Frustration und den Hass auf die Wohlhabenden und Parasiten auszunutzen, die sie als jüdisch oder russisch und niemals als ukrainisch beschreibt.
Das Schlimmste ist, dass während dieser Bewegung, genau wie vor zehn Jahren, diejenigen, die aufrichtig ihre Ablehnung einer verhassten, weil korrupten und repressiven Macht zum Ausdruck bringen wollten, gegenüber den Männern der Macht nur die der Rechten in ihren verschiedenen Varianten, parlamentarisch oder extrem, vorfanden. Diese Rechte fühlte sich übrigens in Ermangelung jeglicher Kraft, die ihr die Hegemonie über die Opposition gegen das Regime streitig machen würde, so sicher, dass sie Anfang Februar sogar erwog, für Ende des Monats zu einem Generalstreik aufzurufen.
Tatsache ist, dass niemand, absolut niemand, versucht hat, die Arbeitenden als solche anzusprechen, geschweige denn im Namen ihrer Klasseninteressen. Und soweit man das aus der Ferne beurteilen kann, standen die Arbeitnehmer zumindest bis Mitte Februar weitgehend außerhalb der Bewegung der letzten Monate. Weil die Menschen, die den Großteil der Protestbewegung ausmachen, und diejenigen, die demonstrieren, auch wenn nicht alle der Rechten oder der extremen Rechten folgen, einer anderen Welt als der der Arbeit angehören? Weil die Arbeiterschaft die von der Bewegung vorgebrachten Ideen instinktiv als fremd, wenn nicht gar feindlich gegenüber ihren Sorgen und Interessen betrachtete?
Soweit wir wissen, hat jedenfalls keine Partei oder Gruppe versucht, den Arbeitenden zu zeigen, warum es sich für sie lohnt, sich sowohl gegen die sogenannte pro-russische Führungsclique mit ihren Oligarchen und Bereitschaftspolizisten als auch gegen die sogenannten pro-europäischen Kräfte zu stellen, deren Ideologie offen ihre Feindseligkeit gegenüber den Interessen der Arbeiterklasse zur Schau stellt.
Zwischen dem Imperialismus auf der einen Seite und Putins Russland und Janukowitschs Bürokratie auf der anderen sieht die arbeitende Bevölkerung der Ukraine sowohl die Berkut als auch die Swoboda-Handlanger gegen sich stehen. Die gegenwärtige Krise macht auf blutige Weise deutlich, wie sehr es an revolutionären Gruppen und Organisationen mangelt, die bereit und in der Lage sind, die Arbeiterklasse dieses Landes in allen ihren Sprachen anzusprechen und eine Klassenpolitik zu vertreten. Eine Politik, die den Arbeitern klarmacht, was sie grundsätzlich gegen ihre Ausbeuter und ihre politischen Diener, gegen das System, auf das sie sich berufen, stellt, und zwar unabhängig von ihrem Etikett oder der Sprache, in der sie ihren Wachhunden Befehle erteilen.