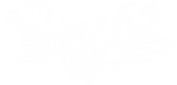Übersetzung aus der Zeitschrift Lutte de Classe (Nr.247, April 2025)
Mit Begriffen wie „Chinafrique“ und „Afrika, zweiter chinesischer Kontinent“ machen Kommentatoren China zur neuen dominierenden Macht des Kontinents. Sie verweisen auf die Anwesenheit von fast einer Million chinesischer Arbeitender (Führungskräfte, Techniker und Arbeiter) in Afrika, auf die Vielzahl der nach Afrika exportierten chinesischen Industrieerzeugnisse sowie der zahlreichen Bergwerke und Bauvorhaben im Bereich der Infrastruktur, an denen China beteiligt ist. Aber auch wenn die Präsenz Chinas in Afrika durchaus real ist, ist es reine Propaganda, daraus einen neuen Imperialismus zu machen.
Während die Präsenz des zweitrangigen Imperialismus Frankreichs zurückgeht, soll das Bild eines siegreichen Chinas dazu dienen, die Reihen hinter dem französischen Staat zu schließen. Macron, der immer schnell mit Ratschlägen zur Stelle ist, formulierte dies 2021 in N'Djamena mit den Worten: „Es hat keinen Sinn, die Schulden Afrikas gegenüber Europa und den Vereinigten Staaten umzustrukturieren, wenn man dafür Schulden bei China macht.“ Die Vereinigten Staaten betrachten China als einen Rivalen, der ihre Vorherrschaft bedroht und den sie in Schach halten müssen, und ihr Druck auf China nimmt überall zu, auch in Afrika.
Eine starke Präsenz Chinas in Afrika
Die Beziehungen zwischen China und Afrika sind alt. Ohne bis zu den chinesischen Händlern zurückzugehen, die sich bereits im 15. Jahrhundert an die Ostküste des Kontinents wagten, markierte der Besuch von Maos Premierminister Zhou Enlai in mehreren afrikanischen Ländern im Jahr 1963 den Beginn einer Politik, die unter anderem zur Entsendung von chinesischen Agronomen und medizinischem Personal nach Afrika führte. Der maoistische chinesische Staat war durch die imperialistischen Mächte noch immer isoliert. Er gab vor, ärmeren Ländern einen Weg aus der Unterentwicklung zu ermöglichen. Manchmal wurden große Bauvorhaben durchgeführt, wie beispielsweise der Bau der Tazara-Eisenbahnlinie (Tanzania-Zambia Railroad) im Jahr 1973. Mindestens 15.000 Arbeiter kamen aus China, um die 1.860 Kilometer lange Strecke zu verlegen, die die Kupfervorkommen Sambias mit dem Hafen von Daressalam in Tansania verbindet.
Aber erst seit den 2000er Jahren haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Afrika wirklich entwickelt. Innerhalb von zwanzig Jahren hat sich ihr Handelsvolumen verdreißigfacht. Zunächst handelte es sich dabei um chinesische Exporte von Billigwaren, Alltagsgegenständen aus Kunststoff, Werkzeugen, Waschschüsseln, Stiefeln, Textilien usw. Diese Billigwaren standen in Konkurrenz zu afrikanischen Produkten, nicht aber zu europäischen Industriegütern. Im Textilbereich waren vor allem Nigeria und Ghana von dieser Konkurrenz betroffen.
Seit mehreren Jahren exportieren chinesische Unternehmen auch Landmaschinen und Fahrzeuge, Kleinwagen, Reisebusse, Motorräder, Lastwagen und Baumaschinen nach Afrika. Die Filialen, die diese verkaufen, sind nicht unbedingt chinesisch: In Abidjan wird dieser Markt von libanesischen oder anderen Händlern bedient. Lange Zeit war das französischsprachige Afrika jedoch ein geschützter Markt für französische Unternehmen wie Peugeot oder Renault Trucks, deren Vorgänger Berliet bereits in der Kolonialzeit Lastwagen dort verkaufte. Heute herrscht ein echter Wettbewerb zwischen chinesischen Herstellern wie Foton oder Sinotruck, deutschen wie Daimler-Benz und italienischen wie Iveco.
Eine erbärmliche Infrastruktur – und nur für den Export ausgelegt
In Afrika sind chinesische Unternehmen vor allem im Baugewerbe allgegenwärtig. Doch auch wenn es einige beachtliche Großprojekte gibt, werden die Grundbedürfnisse der Bevölkerung bei weitem nicht gedeckt. Die Stromproduktion in ganz Afrika südlich der Sahara entspricht der Spaniens. Im Herzen des Kontinents werden für den Großteil des Transports einfachste Transportmittel genutzt. Die wenigen Eisenbahnlinien, die aus der Kolonialzeit stammen, sind baufällig und für den Export von Rohstoffen ausgelegt.
Zwischen 2006 und 2017 war China führend beim Bau von Infrastruktur in Afrika. China stellte hierfür fast 28 % der ausländischen Finanzmittel bereit, Frankreich hingegen nur 6 %. China hat Eisenbahnstrecken wiederhergestellt, die Strecke von Dschibuti nach Addis Abeba in Äthiopien zum Beispiel. Und die Tazara-Strecke soll bald von der staatlichen chinesischen Gesellschaft CCECC wieder instandgesetzt werden. Das 2013 ins Leben gerufene chinesische Programm „Neue Seidenstraßen“ betrifft die Ostküste Afrikas. Zwischen dem Suezkanal, Dschibuti und den Häfen an der Ostküste wurde im Rahmen dieses Programms Infrastruktur für den Warentransport entwickelt. In 21 von 55 afrikanischen Häfen konkurrieren vier große chinesische Staatsunternehmen mit den europäischen Giganten MSC oder Maersk und mit DP World, das dem Emirat Dubai gehört.
Einige afrikanische Staatschefs konnten behaupten, dass die Verträge mit China, seinen Banken und Unternehmen eine wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen würden. Sie schließen Verträge mit China oder Russland ab und jonglieren zwischen den verschiedenen Konkurrenten in dem Versuch, auf diese Weise den Würgegriff des Imperialismus zu lockern. Auch China wurde ein Jahrhundert lang von Imperialisten beherrscht, auch wenn es nie formal zur Kolonie wurde. Diese Vergangenheit ermöglicht es dem chinesischen Staat zu behaupten, dass Wirtschaftsabkommen mit ihm eine „Win-win-Situation” seien. Aber kein Vertrag ist umsonst. Und die afrikanischen Staaten haben sich verschuldet, um die Kredite zurückzuzahlen, die sie für den Bau der Infrastruktur aufnehmen mussten, und zwar meist bei einer der beiden großen, mit dem chinesischen Staat verbundenen Banken: der Exim Bank of China und der China Development Bank.
Zwanzig Jahre nach den ersten Verträgen ist in der Tat Infrastruktur entstanden, die den Export afrikanischer Rohstoffe nach China vereinfacht. Was jedoch die für die Bevölkerung unverzichtbare Infrastruktur angeht, fällt die Bilanz sehr bescheiden aus. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums wurden in zwanzig Jahren in ganz Afrika 80 große Kraftwerke, 130 Krankenhäuser und 45 Stadien gebaut, sowie 6.000 Kilometer Eisenbahnschienen. Zum Vergleich: ein Land wie Frankreich hat 28.000 Kilometern Eisenbahnnetz. China übernimmt zwar zwischen einem Viertel und einem Drittel der Infrastrukturarbeiten in Afrika, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Kapitalismus den Kontinent zur Unterentwicklung verdammt.
Chinas Politik in dem Chaos, das der Imperialismus in Afrika verursacht hat
China ist zu einem wichtigen Handelspartner des Kontinents geworden. 2022 kamen 16% der afrikanischen Importe aus China, gegenüber 29% aus der Europäische Union. Da die europäischen Staaten jedoch gespalten sind und miteinander konkurrieren, hat jedes europäische Land für sich genommen weniger Gewicht als China, was China zum wichtigsten Handelspartner Afrikas macht. Umgekehrt macht der afrikanische Kontinent jedoch nur 3% des chinesischen Außenhandels aus, was der Stellung Afrikas in der Weltwirtschaft entspricht, obwohl dort 18% der Menschheit leben.
Die Importe Chinas aus Afrika sind hingegen beträchtlich. Sie betreffen fast ausschließlich Rohstoffe, Mineralien, Metalle, Erdöl und Erdgas, Holz, Textilfasern und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. Afrikas Rolle in der Weltwirtschaft ist seit Ende des 19. Jahrhunderts die eines Rohstofflieferanten für die großen westlichen Industriemächte, und China hat die gleichen wirtschaftlichen Beziehungen zu Afrika aufgebaut.
Nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank den afrikanischen Staaten in den 1980er und 1990er Jahren drastische Sparpläne aufgezwungen hat (sog. Strukturanpassungsprogramme), haben westliche Unternehmen das Terrain verlassen, das in ihren Augen nicht mehr profitabel genug war. China hat diese Lücke gefüllt – dank des großen Gewichts des Staates und staatlicher Unternehmen in seiner Wirtschaft.
Als China zu einem wichtigen Zulieferer der westlichen Kapitalisten wurde, musste der chinesische Staat die notwendigen Rohstoffe für seine Industrie finden. In Afrika knüpfte er Beziehungen zu einer Reihe von Staaten, um seine Versorgung mit Öl und Mineralien sicherzustellen. Der chinesische Staat schützte seine Unternehmen, die in Afrika tätig wurden und sorgte für die Infrastruktur, die für die Gewinnung der in Afrika reichlich vorhandenen Rohstoffe notwendig ist. Investitionen in Bergwerke in abgelegenen Regionen, Bau und Instandhaltung von Aufbereitungsanlagen für Mineralerze ebenso wie die Instandhaltung von Straßen oder Eisenbahnlinien erfordern erhebliche und riskante Investitionen in politisch instabilen Ländern. Viele europäische und amerikanische Kapitalisten ziehen es daher vor, ihr Kapital anderswo zu investieren. Wenn die Rohstoffpreise fallen, deckt der chinesische Staat die Verluste seiner Unternehmen und ermöglicht ihnen so das Überleben, während westliche Kapitalisten lieber lukrativere Märkte suchen.
Rohstoffe: der Ansturm auf Afrika
Kupfer, Kobalt, Zinn, Wolfram, Tantal... Afrika ist reich an Rohstoffen, die für die moderne Elektro-, Medizin- und Rüstungsindustrie unverzichtbar sind. Mittlerweile herrscht ein harter Wettbewerb zwischen verschiedenen chinesischen und westlichen Unternehmen in Bezug auf den Abbau dieser Rohstoffe. Beim Kobalt war der anglo-schweizerische Konzern Glencore lange Zeit Marktführer. Doch kürzlich wurde er vom chinesischen Unternehmen CMOC (China Molybdenum Company Limited) vom Thron gestoßen.
Allerdings steht dabei weniger auf dem Spiel, als man meinen könnte. Denn der Kobalt-Markt für E-Auto-Batterien ist derzeit aufgrund der Weltwirtschaftskrise und der Konjunkturabschwächung auf dem Automarkt in China gesättigt. Die Automobilhersteller setzen zudem zunehmend auf kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Seit 2022 ist der Kobaltpreis um 75% gefallen, was die kongolesische Regierung im Februar 2025 dazu veranlasst hat, einen temporären Exportstopp zu verhängen. Sie hofft, dass die Preise bald wieder steigen, zeigt damit aber vor allem ihre Ohnmacht und ihre Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten.
Diese Märkte werden von großen Bergbaukonzernen beherrscht: von den anglo-australischen Konzernen Rio Tinto und BHP Billiton, dem anglo-schweizerischen Konzern Glencore und dem südafrikanischen Anglo-American-Konzern. Wenn die Preise für die Rohstoffe hoch sind, bereichern sie die – chinesischen wie westlichen – Kapitalisten, die die Förderung dieser Rohstoffe in der Hand haben. Aber wenn die Rohstoffpreise fallen, ist das eine Katastrophe für Länder, deren Einkommen von den Exporten einer begrenzten Anzahl natürlicher Ressourcen abhängt. So haben die kongolesischen Behörden durch den Exportstopp für Kobalt Tausende von überausgebeuteten Bergarbeitern ihrer Arbeit beraubt und sie damit in noch tiefere Not gestürzt.
Kommentatoren bezeichnen diese Katastrophe als „Rohstoff-Fluch“, so als würde ein Gott die armen Länder für eine vermeintliche Sünde bestrafen. Aber diese Ausbeutung ist keineswegs ein Fluch. Sie ist das Ergebnis des ungleichen Handels, der den Kapitalismus kennzeichnet. Die Industrieländer beziehen die Rohstoffe, die ihre Unternehmen benötigen, aus den armen Länder. Da diese keine industrielle Produktion haben, verarmen sie durch den Import von Industriegütern. China beteiligt sich an diesem ungleichen Handel, allerdings lange in einer untergeordneten Position, da selber abhängig von amerikanischen oder europäischen Industriekonzernen.
Ungleiche Rivalen oder Verbündete
Chinesische Unternehmen werden oft als gefährliche Konkurrenten europäischer oder amerikanischer Firmen dargestellt, sind jedoch in vielen Bereichen mit großen westlichen Konzernen verbunden. In Uganda fördert die China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) gemeinsam mit dem französischen Total-Konzern Öl aus dem Albertsee. An diesen Projekten mit den Namen Tilenga und EACOP sind auch chinesische Banken als Geldgeber beteiligt. Aber der eigentliche Chef ist Total, der seinen Partnern seine Regeln diktiert und sie den Staaten aufzwingt, gestützt auf die uneingeschränkte Unterstützung der französischen Behörden.
Im Bereich der Telekommunikation hat der private Konzern Huawei seit Ende der 1990er Jahre maßgeblich zum Aufbau der digitalen Netze in Afrika beigetragen – ein Bereich, der von den westlichen Kapitalisten vernachlässigt wurde. Obwohl Huawei von seinen europäischen und amerikanischen Kritikern oft bezichtigt wird, für den chinesischen Staat zu spionieren, übernimmt er teilweise die Wartung der Netze des französischen Konzerns Orange, einem der wichtigsten Mobilfunk- und Zahlungsdienstleister in Afrika.
Im Baugewerbe werden viele Wasserkraftwerke, Brücken und Straßen von chinesischen Konzernen unter Beteiligung westlicher Firmen gebaut. In der Elfenbeinküste wurde der 2017 eingeweihte Staudamm von Soubré, der 14% des Stroms im Land produziert, vom Konzern Sinohydro gebaut und mehrheitlich von der Exim Bank of China finanziert. Doch die vier Turbinen, die zu den technologisch anspruchsvollsten Teilen mit der höchsten Wertschöpfung gehören, wurden vom französischen Alstom-Konzern gebaut. Und das Umweltmanagement des Projekts wurde von Tractebel, einer Tochtergesellschaft des Engie-Konzerns übernommen.
Bei Fahrzeugen kann sich hinter einer sogenannten „chinesischen“ Produktion Verbindungen zu westlichen Kapitalisten verbergen, bei der China als Subunternehmen für die amerikanischen, japanischen oder europäischen Imperialisten fungiert. Der chinesische Hersteller Foton verkauft in Afrika Lkw unter der Lizenz von Daimler-Benz, „Low-Cost“-Fahrzeuge, die in Europa seit Jahrzehnten unverkäuflich sind. In Tunesien produziert Peugeot zusammen mit Dongfeng einen Pick-up, der auf einem alten Modell des japanischen Herstellers Nissan beruht. Die Automobilhersteller sind sowohl Konkurrenten, die bereit sind, „vom Teller des Nachbarn zu essen“, wie es der ehemalige CEO von Stellantis ausdrückte, als auch vorübergehende Verbündete im Handelskrieg, den sie gegeneinander führen.
China, eine imperialistische Macht in Afrika?
Der Begriff „Chinafrique“, der den Verteidigern der Interessen des französischen Imperialismus, die den Begriff „Françafrique“ stets abgelehnt haben, so sehr am Herzen liegt, entspricht nicht der Realität. China investiert zwar auf dem gesamten Kontinent, aber Afrika besteht aus 54 Ländern und ist keine homogene Einheit. China hat nur mit einer kleinen Anzahl von Ländern enge Beziehungen und zwischenstaatliche Abkommen zu Wirtschaftsverträgen geknüpft: Südafrika, Algerien, Angola, die Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Nigeria und Sudan. Vor allem hat China dort kein koloniales Erbe, und seine Investitionen sind sehr bescheiden. Einige, darunter auch Vertreter der extremen Linken, sprechen jedoch von einem neuen chinesischen Imperialismus und führen als Beweise die Neuen Seidenstraßen, den wirtschaftlichen Einfluss Chinas in Häfen und Bergwerken sowie die Schulden an, die einige Staaten bei China haben.
China hat zwar in verschiedenen afrikanischen Ländern steuerfreie Wirtschaftszonen eingerichtet, um die Ansiedlung chinesischer Kapitalgeber zu fördern, aber mit begrenztem Erfolg. Die von China finanzierten Eisenbahnlinien erweisen sich oft als unrentabel oder sogar defizitär, wie beispielsweise die Strecke von Addis Abeba nach Dschibuti. Chinesische Angestellte staatlicher Unternehmen sind in Afrika geblieben, haben Geschäfte eröffnet oder ihre Familien aus ländlichen Gebieten nachgeholt, um intensive Schweine- oder Hühnerzuchtbetriebe zu gründen, deren Produkte teurer verkauft werden können als in China. In einigen Ländern wurden lokale Eier- oder Hühnerproduzenten durch produktivere chinesische Betriebe verdrängt. Aber im weltweiten Wirtschaftskrieg wiegt Hühnerfleisch nicht schwer.
Bis 2016 haben die vier großen, staatlich kontrollierten chinesischen Banken einigen afrikanischen Staaten hohe Kredite gewährt. Diese Kredite sind jedoch seitdem stark zurückgegangen. Zum einen, da ihre Rückzahlung immer unsicherer wird, aber auch, weil die chinesische Wirtschaft selber in Schwierigkeiten steckt. China hält heute nur noch 8% der afrikanischen Staatsschulden, private Geldgeber hingegen 60%. Und diese Geier sind vor allem westliche Fonds: die US-Banken Citigroup, JPMorgan, Bank of America, der Fonds BlackRock, die britische Barclays-Bank, der deutsche Versicherer Allianz, Crédit Agricole, BNP-Paribas und die Société Générale.
In Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus bezeichnete Lenin den Kapitalexport als grundlegendes Merkmal des Imperialismus. In dieser Hinsicht sind die Direktinvestitionen Chinas in Afrika weitaus geringer, als die Propaganda der Verteidiger des westlichen Imperialismus behauptet. Im Jahr 2021 lagen diese Investitionen aus China an fünfter Stelle hinter den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Sie beliefen sich in diesem Jahr auf 4,9 Milliarden Dollar für ganz Afrika. Zum Vergleich: So viel investiert der US-Konzern Pepsi allein in Mexiko.
Hinter dem bescheidenen Betrag verbirgt sich auch ein qualitativer Unterschied. Das westliche Kapital stammt vor allem von privaten Unternehmen, die frei kommen und gehen können. Das Kapital aus China gehört hauptsächlich großen Unternehmen, die mit der Zentralregierung oder den Regierungen der chinesischen Provinzen verbunden sind. Dass diese chinesischen Unternehmen mit am Tisch sitzen können, verdanken sie der Vormundschaft ihres mächtigen und zentralisierten Staates. Aber sie spielen nicht in derselben Liga wie ihre westlichen kapitalistischen Konkurrenten.
Die USA setzen China unter Druck
Doch während sich die Krise verschärft und der Wirtschaftskrieg eskaliert, wächst auch der Druck der USA auf China auf dem afrikanischen Kontinent. Insbesondere die Kontrolle über die Gewinnung und den Transport von Metallen ist zum Gegenstand von Rivalitäten geworden. Denn nach Ansicht der Imperialisten wird dieser wichtige Sektor zu sehr von China dominiert. Europa, das in eine Vielzahl von kapitalistischen Klassen und konkurrierenden Staaten zersplittert ist, ist angesichts des wirtschaftlichen Gewichts Chinas nicht groß genug. Die Vereinigten Staaten hingegen haben die Mittel, ihre Interessen zu verteidigen, und zögern nicht, einzugreifen, wenn sie es für notwendig halten.
In Angola haben die Vereinigten Staaten unter dem Vorwand, den Transport von Mineralien zu beschleunigen und sicherer zu machen, in den „Lobito-Korridor“ investiert, eine alte Eisenbahnlinie, die den angolanischen Hafen Lobito mit Katanga im Süden der Demokratischen Republik Kongo verbindet. Ende 2024 besuchte Joe Biden Lobito und kündigte weitere 500 Millionen Dollar an, bei einer Gesamtinvestition von 1,6 Milliarden Dollar. Das chinesische Konsortium, das sich um den Auftrag beworben hatte, wurde zugunsten eines anderen Konsortiums unter der Führung des Schweizer Handelsunternehmens Trafigura, das in mehrere Korruptionsskandale verwickelt ist, abgelehnt. Diese Details hinderten Joe Biden jedoch nicht daran, die Präsenz Chinas in Afrika anzuprangern und zu behaupten, dass es dort ein „Programm der Verschuldung und Konfiszierung” gebe. Ausgerechnet von der herrschenden imperialistischen Macht ist dies ein schlechter Scherz.
Zwar hat China in den letzten zwei Jahrzehnten die für den Export der natürlichen Ressourcen des Kontinents unverzichtbaren Infrastrukturarbeiten in Angriff genommen und den afrikanischen Staaten, die von westlichen Finanziers in die Knie gezwungen worden waren, Kredite gewährt, aber es ist weit davon entfernt, der von Biden beschworene skrupellose Wucherer zu sein. In der Weltwirtschaft spielt China die Rolle eines Zulieferers und verfügt nicht über die gleichen Waffen wie die imperialistischen Mächte, um die Interessen seiner Unternehmen zu verteidigen, die im Wesentlichen staatlich und nicht privat wie das westliche Großkapital sind. Ein weiterer entscheidender Indikator dafür, dass China keine imperialistische Macht ist, ist sein begrenztes militärisches Gewicht in Afrika.
Imperialismus und militärische Präsenz
Obwohl die chinesische Armee zahlreich und gut ausgerüstet ist, ist sie derzeit nicht in der Lage, in Afrika militärisch zu intervenieren, Soldaten auszubilden oder verbündete Regime zu unterstützen, wie es Frankreich jahrzehntelang in seinem ehemaligen Kolonialreich getan hat und wie es die Vereinigten Staaten überall tun.
Seit 2017 verfügt der chinesische Staat zwar über einen Stützpunkt in Dschibuti, der aber vor allem logistische Aufgaben erfüllt, insbesondere für die sogenannten Blauhelm-Einsätze der UNO. Die chinesische Armee stellt Blauhelm-Soldaten: 2023 waren 1.852 Soldaten in Afrika im Einsatz, darunter in Mali, im Südsudan, in Darfur, in der Demokratischen Republik Kongo und in der Zentralafrikanischen Republik. Das ist weit entfernt von den 6.000 US-Soldaten, die in Afrika unter dem Kommando von Africom, dem Militärkommando der US-Armee für Afrika, im Einsatz sind. Außerdem kommen hier noch die 4.000 Soldaten auf der US-Militärbasis in Dschibuti hinzu, die sich in der Nähe der sehr alten französischen Militärbasis mit weiteren 1.450 Soldaten befindet. Das US-Militärkommando Africom, das 29 Stützpunkte in 15 afrikanischen Ländern unterhält, soll darüber hinaus mindestens ebenso viele Söldner privater Militärunternehmen beschäftigen, die diskret im Interesse des US-Imperialismus agieren. China hat nichts Vergleichbares.
Auch bilden noch immer Frankreich und Großbritannien und zunehmend auch die Vereinigten Staaten den Großteil der Offiziere der afrikanischen Armeen aus. Diese Beziehungen zeigen ihre Abhängigkeit von den imperialistischen Mächten, allen voran den Vereinigten Staaten, die jedes Jahr Militärübungen organisieren, bei denen ihre Offiziere und die der afrikanischen Armeen Kontakte knüpfen. Kapitalexport, militärische Einflussnahme, Untergrabung der Konkurrenz, Verflechtungen in allen Ländern – auch das sind Merkmale imperialistischer Herrschaft. In all diesen Bereichen steckt China noch in den Kinderschuhen.
Ob aus China oder anderswo, die Bosse bleiben Ausbeuter
Auch ohne bislang selbst eine große imperialistische Macht zu sein, stehen die chinesische Unternehmen diesen in Sachen Ausbeutung der Arbeiterklasse in nichts nach. Bis 2016 holten sie ihr Personal, darunter auch Facharbeiter, meist aus China. Doch mittlerweile stellen sie zunehmend afrikanische Arbeiter ein. Ihre Position als Zulieferer in oft weniger rentablen Branchen führt dazu, dass sie besonders brutale Methoden anwenden. In der Elfenbeinküste kann ein qualifizierter Schalungsbauer, der für eine Tochtergesellschaft des französischen Bau-Konzerns Bouygues arbeitet, 12.000 CFA-Francs pro Tag verdienen. In chinesischen Baufirmen erwartet ihn ein Lohn von etwa 4.000 Francs (ca. 6 Euro) pro Tag, manchmal sogar weniger. Um zumindest 7.000 bis 8.000 CFA-Francs zu verdienen, muss man viele Überstunden machen und sieben Tage die Woche arbeiten.
Chinesische Firmen sind daher bei den Arbeitenden nicht besonders beliebt, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie anti-chinesische Ressentiments hegen. In chinesischen Unternehmen besetzen die Bosse selbst die kleinen Vorgesetztenposten immer noch mit Leuten aus China, ohne dass diese jedoch privilegiert wären. Sie leben sparsam und arbeiten viele Stunden, weit entfernt von den komfortablen Bedingungen der „expatriierten” europäischen Führungskräfte, die über ein Auto, Freizeitaktivitäten und Hauspersonal verfügen.
Hinter den chinesischen Bossen stehen als erste Profiteure europäische Beratungsunternehmen, große westliche Banken und Konzerne wie die französische CMA CGM oder die italienisch-schweizerische MSC, die den Containerverkehr und die Häfen kontrollieren. Die chinesischen Bosse sind jedoch sichtbarer, da ihre kleinen Vorgesetzten als Aufseher fungieren, um die Arbeiter auszubeuten. Manchmal gelingt es den Arbeitern durch Streiks, Lohnerhöhungen oder Maßnahmen zur Arbeitssicherheit durchzusetzen.
In ihrer Zeitung Le Pouvoir aux travailleurs (Die Macht den Arbeitern) vom Dezember 2024 berichten unsere Genossen der UATCI (Afrikanische Union der Kommunistischen Internationalistischen Arbeiter) von einem Streik auf einer Baustelle von Sinohydro, auf der 300 Arbeiter beschäftigt sind. Ein Streikender berichtet: „Wir arbeiten zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, für einen Hungerlohn. Wir haben uns organisiert, um 3.000 CFA-Francs mehr pro Tag für alle zu fordern […]. Am frühen Morgen des 9. Januar begannen die Streikposten, über die gesamte Baustelle zu gehen, um möglichst viele unserer Kollegen zum Streik aufzurufen. Gegen 10 Uhr war die gesamte Baustelle lahmgelegt […]. Da unsere Bewegung großen Zuspruch fand, sah sich die Geschäftsleitung gezwungen, eine Delegation der Streikenden zu empfangen und eine erste Zahlung ab dem 20. Januar zuzusagen. In dieser Stimmung nahmen wir am nächsten Morgen die Arbeit wieder auf – nach einer kurzen Versammlung, in der wir beschlossen hatten, was wir tun, sollte diese Zusage am 20. Januar nicht gehalten werden. Wir lassen uns nicht täuschen. Wir haben es mit Kapitalisten zu tun, diese Leute verstehen nur die Sprache der Gewalt.“
Nicht in die Falle der nationalen Einheit tappen, weder in Afrika noch in Europa
Die chinesischen Kapitalisten und der chinesische Staat sind keine Verbündeten der Ausgebeuteten Afrikas, ebenso wenig wie die russischen Bürokraten und Oligarchen unter Putin. Afrikanische Führer wie die Militärs an der Spitze Malis oder Burkina Fasos mögen bei ihnen nach Unterstützung suchen, um den imperialistischen Würgegriff etwas zu lockern. Aber sie sind bereit, den geringsten Widerstand, den kleinsten Streik niederzuschlagen, und sie wurden dafür in westlichen Militärschulen ausgebildet. Sie alle können weder die Interessen der armen Massen vertreten noch ihnen eine Stütze sein.
Die Propaganda, die in Frankreich gegen die chinesische oder russische Präsenz in Afrika betrieben wird, ist natürlich nicht besser. Sie zielt darauf ab, unter dem Deckmantel der Verteidigung der Demokratie, die Interessen von Konzernen wie Total zu verteidigen und künftige imperialistische Interventionen dort vorzubereiten. In Subsahara-Afrika und im Maghreb gibt es nun zahlreiche chinesische Arbeiter, und auch wenn ihr Schicksal etwas besser erscheint als das ihrer afrikanischen Brüder, so gehören sie alle derselben Arbeiterklasse an. Diese Arbeiterklasse repräsentiert die Zukunft, hier ebenso wie in den Hochburgen des Weltimperialismus.
28. März 2025